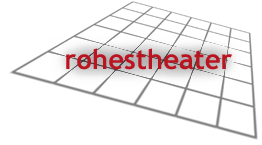2001 / 2002
Galilei
Galilei
„Wir stehen wirklich erst am Beginn“
(B. Brecht)
Mit dem Satz „Wir stehen wirklich erst am Beginn.“ endet Brechts Drama. - Recht sollte er behalten, bedenkt man z.B. die zukünftigen, womöglich irreversiblen Manipulationen am menschlichen Genom, die uns aufschrecken lassen. Oder betrachtet man den aktuellen religiösen Fundamentalismus, der seinen Grund in der Heimatlosigkeit des neuzeitlichen Menschen hat, lässt Brecht Galilei dazu sagen: „Die Himmel, hat es sich herausgestellt, sind leer. Darüber ist ein fröhliches Gelächter entstanden.“ (1.Bild). Hier finden sich gegenwärtige Bezüge zu unserem Stück. Der „Galilei“ ist vielleicht Brechts „Lebenswerk“, immerhin arbeitete er an ihm von 1938 bis zu seinem Tod 1956 und erstellte drei Fassungen, die eine Wandlung der Hauptfigur vom Helden zum Antihelden beschreiben und sich an den jeweiligen zeitgenössischen Ereignissen orientierten. Der Held der neuzeitlich-naturwissenschaftlichen Aufklärung - ursprünglich gegen den Dogmatismus der Kirche gewendet - wird zum skrupellos-technischen, egoistischen Wissenschaftler, mit dessen Forschung das neue, materialistische Zeitalter Einzug hält und der laut und ebenfalls dogmatisch in der Figur des Andrea sein Credo einfordert: „Die Wissenschaft kennt nur ein Gebot: den wissenschaftlichen Beitrag.“ (14. Bild). Die diesjährige „Galilei“ Inszenierung knüpft an die vorherige „Gen 3.5“ an und versteht sich als deren Fortsetzung. Vom „Baum der Erkenntnis“ zur Erkenntnis des heliozentrischen Weltbildes ist kein langer Weg, er geht einher mit dem Verlust des Gefühls für die „Heiligkeit“ des Lebens. Unsere alte Bühne, eine von Höhlenmalerei geprägte erdfarbige „Weltscheibe“ hat sich in ein Neongrün verwandelt, die Atmosphäre wird futuristisch-künstlich, Plastik als Ausdruck menschlicher „Schöpfungskraft“ hält Einzug, der „Riss“, der die Bühne in zwei Hälften teilte, ist schärfer geworden, so dass die Balance zu halten schwerer fällt. Wir wollen unser Stück nicht als larmoyante Klage über die Verantwortungslosigkeit des Wissenschaftlers verstehen. Wer weiß denn heute noch, ob es „gut“ oder „böse“, „richtig“ oder „falsch“ gibt? Aber fest steht, das vorherrschende Gesetz lautet: „Skudi wert ist nur, was Skudi bringt.“ (1.Bild). Was wir sehen, ist menschliches Nützlichkeitsdenken, was gedacht wird, wird gemacht und vielleicht sind die von Expertengremien und Ethikkommissionen aufkommende Appelle an die „Moral“ ja letztlich nur hilfloses Alibihandeln oder selbstgerechter Selbstbetrug?
Zur Gruppe:
Wir kommen von der Mies-van-der-Rohe-Schule Aachen, einem Berufskolleg für Technik. Unsere Gruppe besteht seit 1992 aus der Kombination von Theater AG und Literaturkurs der Jahrgangsstufen 12 und 13. Zudem spielen auch ehemalige Schüler, Schüler anderer Schulen und Auszubildende in unserer Gruppe mit. Wir bewerben uns bei diversen Festivals, um neue Anregungen und Ideen zu bekommen und außerhalb der Schule zu bestehen.
Besondere Aufführungen:
Theaterwoche Korbach
Deutsches Staatstheater in Timisoara (Temeswar) und Gongtheater in Sibiu (Hermannstadt) / Rumänien.
Dort spielten als Ersatz für acht Ensembelmitglieder: Bernd Jansen, Christian Pongratz, Niko Robens, Udo Sistermann und Stephan Wilden.
Schauspiel:
Hella Arns, Hossein Asgari, Oliver Bachmann, Gül Emre, Markus Ethen, Alexander Helmedag, Jens Hoffmann, Thomas Kremer, Michaele Meyer, Patrick Philipp, Alexandra Pitz, Marcel Pitz, Ute Pötter, Christine Schröter, Kohan Schumacher, Michael Stork, Christian von Thenen
Technik:
Bianca Dittmann, Dennis Dreßler, Benedikt Richtsteig, Ralph Schramm, Wilfried Schumacher, Christian Tein, Pascal Wickmann
Plakat:
Benedikt Richtsteig, Wilfried Schumacher
Bühnenbild, Fotos und Video:
Wilfried Schumacher und die Technik
Regie:
Eckhard Debour